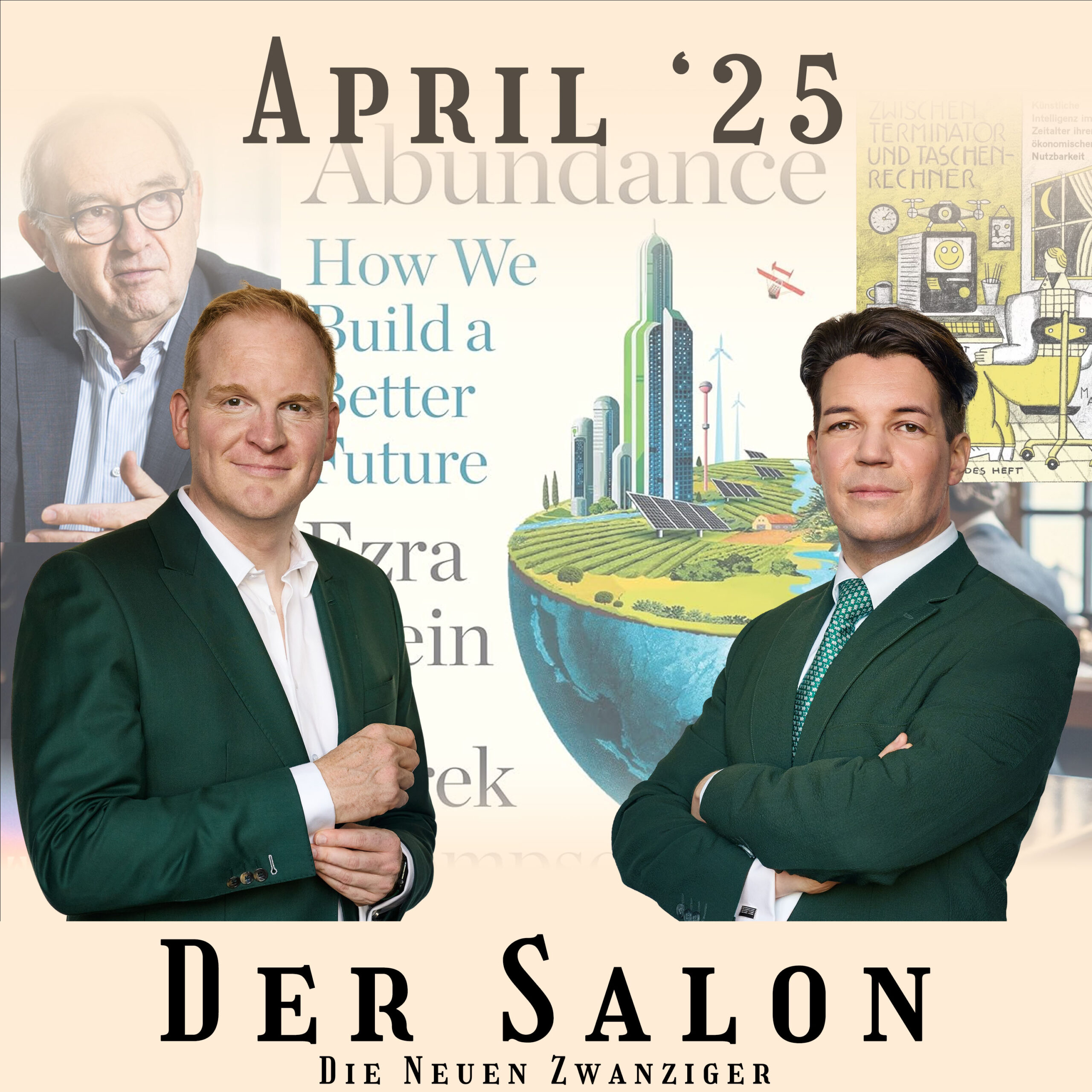 Ezra Klein ist bekannt für kluge Gedanken die häufig gerade so den Korridor des Konventionellen verlassen. Diesmal schreibt er, zusammen mit Derek Thompson, aber über das Offensichtlichste – zu wenig Wohnung, zu wenig Infrastruktur, zu wenig Forschung. Man wartet auf den Markt und der liefert nicht. Man wartet auf den Staat und der fühlt sich nicht verantwortlich. Das Unkonventionelle ist diesmal die politische Gegnerschaft. Die Republikaner sind schon abgeschrieben. Aber die Demokraten, die könnten noch was erreichen, wenn sie sich von ihrem bisherigen Plan von Politik vollständig verabschieden und ins Zeitalter des konstruktiven Überflusses einstiegen. Das Buch ist auch für uns Deutsche hoch interessant. Wir lesen es dennoch kritisch. Dann stellt uns Wolfgang Literatur vor, die ihren Leser nicht vergisst. Stefan spricht über Trumps Fertilitätspolitik. Zum Abschluss gibt es eine Empfehlung für Nachtmusik.
Ezra Klein ist bekannt für kluge Gedanken die häufig gerade so den Korridor des Konventionellen verlassen. Diesmal schreibt er, zusammen mit Derek Thompson, aber über das Offensichtlichste – zu wenig Wohnung, zu wenig Infrastruktur, zu wenig Forschung. Man wartet auf den Markt und der liefert nicht. Man wartet auf den Staat und der fühlt sich nicht verantwortlich. Das Unkonventionelle ist diesmal die politische Gegnerschaft. Die Republikaner sind schon abgeschrieben. Aber die Demokraten, die könnten noch was erreichen, wenn sie sich von ihrem bisherigen Plan von Politik vollständig verabschieden und ins Zeitalter des konstruktiven Überflusses einstiegen. Das Buch ist auch für uns Deutsche hoch interessant. Wir lesen es dennoch kritisch. Dann stellt uns Wolfgang Literatur vor, die ihren Leser nicht vergisst. Stefan spricht über Trumps Fertilitätspolitik. Zum Abschluss gibt es eine Empfehlung für Nachtmusik.
- Hinweis: Der kürzlich erwähnte vernünftige Fitness-Influencer ist: Colin! Folgt bei der Gelegenheit doch bitte auch uns. Ihr findet Wolfgang bei Instagram. Und Stefan braucht endlich 10.000 Follower…
KÄS-Termine 2025: Fr. 20.06. / Fr. 19.09. / Fr. 19.12. per Mail: neuezwanziger@diekaes.de SOMMERSALON am 23. August! Tickets gibts hier
Komm’ in den Salon. Es gibt ihn via Webplayer & RSS-Feed (zum Hören im Podcatcher deiner Wahl, auch bei Apple Podcasts und Spotify). Wenn du Salon-Stürmer bist, lade weitere Hörer von der Gästeliste ein.
Literatur
- Fülle und Wohlstand wünschen sich Ezra Klein und Derek Thompson in ihrem Buch „Abundance. How We Build a Better Future“. In liberalen Demokratien wird immer weniger gebaut, erfunden und verteilt. Warum ist das so? Das Buch richtet sich primär an und gegen Liberale und Linke. simonandschuster.com
- Risikoinvestor Albert Wenger beschreibt in seinem Buch „Die Welt nach dem Kapital“ eine eigenartige Vision von einer Zukunft, in der es außer bei der Aufmerksamkeit keine Knappheiten mehr gibt und ein BGE die Rettung sein soll. piper.de
- „Künstliche Intelligenz im Zeitalter ihrer ökonomischen Nutzbarkeit“ heißt ein hochinteressanter Essay von Peter Schadt, der als Maro-Heft erschienen ist und von Luise Schaller illustriert wurde. Die Dystopie, so die These des Autors, ist bereits da. maroverlag.de
- Donald Trump hat eine ausgefeilte Fertilitätspolitik. Aber seine bürokratiefeindliche Politik steht dieser entgegen. Die New York Times beobachtet es detailliert. nytimes.com
- Ein Meinungsbeitrag der New York Times über Trumps Fertilitätspolitik und Sexismus. nytimes.com
- Ein Artikel der New York Times über Trumps Fertilitätspolitik im Gesundheitsbereich. nytimes.com
- Die Rechtswissenschaftlerin Katharina Pistor spricht in einem „Handelsblatt“-Interview über die Repressionen an US-Universitäten. handelsblatt.com
- Andreas Püttmann hat in den „Blättern“ das Christliche, Soziale und Konservative der CDU/CSU historisch erörtert. blaetter.de
- Die amerikanische Schriftstellerin Jo Ann Beard schlägt in ihrem Erzählungsband „Cheri“ (übersetzt von Anke Caroline Burger) einen unvergleichlichen Ton an, der von Alltagsbetrachtungen ausgehend ins Abgründige schwingt und doch heiter bleiben möchte. harpercollins.de
- Norbert Walter-Borjans kritisiert das SPD-Verhandlungsergebnis im Koalitionsvertrag. Wir vergleichen den Koalitionsvertrag und das SPD-Wahlprogramm. freitag.de
- Die Linke hat den zweiten Wahlgang ermöglicht, sodass Friedrich Merz nach wenigen Stunden doch noch zum Kanzler gewählt wurde. Eine Formalie? Nein, sagt Sebastian Friedrich in „Jacobin“. jacobin.de
- John Field ist der Erfinder des Nocturnes, aber der Komponist ist bis heute völlig unbekannt. Pianistin Alice Sara Ott legt nun eine wundervolle Einspielung seiner Nachtstücke vor. deutschegrammophon.com
Shownotes
Vor dem Salon
- Der neue Papst Leo XIV.: Wolfgang äußert sich erfreut über die Namenswahl des neuen Papstes, die an Leo XIII. und dessen soziale Ausrichtung anknüpft. Sie diskutieren mögliche programmatische Ausrichtungen und Besuche des neuen Papstes, insbesondere im Kontext der US-Politik und Donald Trump.
- Die AfD und der Verfassungsschutz: Stefan thematisiert die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und die mögliche Auswirkung auf Wähler und den politischen Diskurs. Wolfgang hinterfragt die tatsächliche Relevanz dieser Einstufung für AfD-Wähler und die Rolle des Verfassungsschutzes aus linker Perspektive. Sie diskutieren die passive Haltung von Bürgern und die Verantwortung für politische Entwicklungen, illustriert durch einen Buchauszug über „Unwillige Volksgenossen“ im Dritten Reich und einen Clip von Lanz und Precht über das Verhalten der Deutschen nach Kriegsende.
- Politische Debattenkultur und Interessenpolitik: Wolfgang kritisiert Kevin Kühnerts Aussage, dass man dem politischen Gegner immer Recht geben können müsse, und betont, dass Politik primär Interessenpolitik sei und nicht nur ein Austausch vernünftiger Argumente. Stefan stimmt zu und verweist auf Jordan Petersons Theorie der „psychopathischen Parasiten“ in politischen Bewegungen, die emotionale Aufgewühltheit für narzisstische Vorteile nutzen. Sie analysieren dies am Beispiel von Politikern wie Jens Spahn.
- Moderne Politik und Führung: Die Diskussion weitet sich auf die Natur moderner Politik aus, die Schwierigkeit, geeignete Führungspersönlichkeiten zu finden, und die Rolle von Inszenierung und Rhetorik, illustriert am Beispiel des Films „Konklave“.
- Korrekturen und Nachträge: Stefan korrigiert eine frühere Aussage (Bayer kaufte Monsanto, nicht BASF) und Wolfgang nennt den Instagram-Account eines zuvor erwähnten Fitnesscoaches (Colin Coaches).
- Technische und private Anmerkungen: Kurze Diskussionen über Smartphone-Nutzung und Wolfgangs neues iPhone sowie seine Erfahrungen mit der DB Lounge runden das Vorgespräch ab.
Ezra Klein, Derek Thompson: Abundance. How We Build a Better Future
Stefan und Wolfgang diskutieren das Buch „Abundance“ von Ezra Klein und Derek Thompson, das sich kritisch mit der Unfähigkeit auseinandersetzt, eine bessere Zukunft zu bauen, sowohl im Neoliberalismus als auch bei Linken und Liberalen.
- Kritik am Status Quo: Das Buch kritisiert, dass sowohl Republikaner als auch Demokraten in den USA primär nachfrageorientierte Politik betrieben haben, ohne ein ausreichendes Angebot zu schaffen, insbesondere in Bereichen wie Wohnen, Bildung und Medizin. Dies führe zu einer „unheimlichen Wirtschaft“, in der die Leistungsfähigkeit von Staat und Individuum überschritten sei.
- Die Notwendigkeit staatlichen Handelns: Die Autoren plädieren dafür, dass der Staat eine aktivere Rolle beim Bauen von Infrastruktur (Züge, Wohnungen) und der Förderung von Forschung übernehmen müsse. Sie kritisieren die Idee, dass der Markt alle Probleme lösen könne, und sehen die Wohneigentumsgesellschaft als Fehler.
- Bürokratiekritik und Umweltschutz: Ein zentrales Thema ist, wie gut gemeinte Regulierungen, insbesondere im Umweltschutz, zu einer Lähmung und Verteuerung des Bauens geführt haben. Kalifornien dient hier als Negativbeispiel, wo demokratische Politik zu hohen Kosten und Obdachlosigkeit geführt hat.
- Degrowth vs. Innovation: Die Autoren lehnen Degrowth-Ansätze ab, da diese politisch nicht realisierbar seien und zu populistischem Autoritarismus führen könnten. Stattdessen setzen sie auf technische Innovationen, insbesondere bei erneuerbaren Energien, deren Kosten drastisch sinken.
- Der Fall Corona und der unternehmerische Staat: Die schnelle Entwicklung von mRNA-Impfstoffen während der Corona-Pandemie (Operation Warp Speed) wird als Beispiel für erfolgreiches staatliches Handeln und die Mobilisierung von Ressourcen angeführt, wobei die Rolle des Staates als „unternehmerisch“ diskutiert wird.
- Abschließende Kritik und der Verweis auf Marx: Wolfgang kritisiert, dass das Buch letztlich versuche, den Kapitalismus mit kommunistischen Zielen zu versehen, ohne dessen grundlegende Eigentumsordnung in Frage zu stellen. Das Buch zitiert Marx‘ Analyse der „Fesselung der Produktion“ durch Profitgier, ohne jedoch dessen radikale Konsequenzen zu ziehen.
Albert Wenger: Die Welt nach dem Kapital
Die Diskussion wendet sich Albert Wengers Buch „Die Welt nach dem Kapital“ zu, das die These vertritt, dass das Industriezeitalter vorbei sei und es nun primär um die Verteilung von Aufmerksamkeit gehe.
- Grundlegende Kritik an der Prämisse: Stefan und Wolfgang kritisieren die Ausgangsthese des Buches als realitätsfern, da materielle Produktion und Infrastruktur weiterhin zentral seien.
- Wengers Lösungsvorschläge: Wengers drei Säulen für den Übergang – wirtschaftliche Freiheit (BGE), Informationsfreiheit (Abschaffung des Urheberrechts) und psychologische Freiheit (Achtsamkeit) – werden als unausgegoren und problematisch bewertet.
- Absurde Beispiele und Argumentationen: Mehrere Zitate aus dem Buch werden als inkonsistent und weltfremd kritisiert, beispielsweise Wengers Definition von Knappheit oder seine Idee, dass Sachkapital nicht mehr knapp sei und das Bild des Star Trek-Replikators.
- Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE): Wengers Vorschlag zum BGE wird als widersprüchlich entlarvt, da er gleichzeitig eine Besteuerung von Geringverdienern ab dem ersten verdienten Dollar vorsieht und den Mindestlohn abschaffen will, was letztlich zu einer Aufstockerpolitik führen würde.
- Weitere kontroverse Ideen: Wengers Vorschläge zur Reduzierung der Geldmenge durch Negativzinsen auf Spareinlagen, zur Demokratie durch Delegiertenwahlen und zur Abschaffung der Privatsphäre zugunsten des technologischen Fortschritts werden ebenfalls kritisch gesehen. Das Buch wird insgesamt als unbrauchbar und schlecht geschrieben bewertet.
Peter Schadt: Künstliche Intelligenz im Zeitalter ihrer ökonomischen Nutzbarkeit
Wolfgang stellt Peter Schadts Essay vor, der KI aus einer marxistisch geprägten Perspektive beleuchtet und gängige KI-Debatten hinterfragt.
- Die materielle Grundlage der KI: Der Essay betont die oft übersehene menschliche Arbeit hinter der KI, von der Programmierung bis zum Training durch Clickworker im globalen Süden, die unter prekären Bedingungen arbeiten (Vergleich mit Benjamins Schachtürke).
- KI und Produktivitätssteigerung: Schadt argumentiert, dass die durch KI erreichte Produktivitätssteigerung oft zu einer Arbeitsverdichtung für Angestellte führt, während ihr Lohn im Verhältnis zur geleisteten Arbeit sinkt, was den Klassenkampf verschärfen müsste.
- Dystopie als Realität: Der Essay kritisiert die Fokussierung auf ferne dystopische Szenarien (Superintelligenz etc.) und argumentiert, dass die KI bereits jetzt eine Gefahr für Arbeiter darstellt und in Bereichen wie autonomen Waffensystemen dystopische Realitäten schafft (Beispiel Gaza).
- Die Nützlichkeit im Kleinen: Stefan ergänzt, dass die Diskussion oft die alltäglichen Nützlichkeiten der KI übersieht, die Kleinarbeiten erleichtern, und fordert eine Kartografie dieser kleinen Veränderungen.
NYT-Autoren zu Trumps widersprüchlicher Fertilitätspolitik
Stefan fasst mehrere Artikel aus der New York Times zusammen, die sich mit Donald Trumps Bestrebungen zur Steigerung der Geburtenrate in den USA auseinandersetzen.
- Maßnahmen und Vorschläge: Es werden verschiedene Maßnahmen diskutiert, von der Erweiterung des Zugangs zur In-Vitro-Fertilisation über steuerliche Anreize und Babyprämien bis hin zu ideologisch aufgeladenen Vorschlägen wie einer „Nationalen Medaille für Mutterschaft“ für Frauen mit sechs oder mehr Kindern und lebenslanger Steuerbefreiung nach ungarischem Vorbild.
- Widersprüche und kontraproduktive Politik: Die Artikel zeigen auf, wie Trumps Regierung gleichzeitig Forschungseinrichtungen wie das CDC, die für Fruchtbarkeitsforschung zuständig waren, Mittel kürzt und Programme zur reproduktiven Gesundheit abbaut, was ihren eigenen Zielen entgegenwirkt.
- Der Faktor „Vibe“: Es wird betont, dass ein positiver gesellschaftlicher „Vibe“ und eine unterstützende Perspektive für Familien entscheidend sind, was durch Trumps chauvinistische Politik und den daraus resultierenden Druck konterkariert wird. Die Diskrepanz zwischen Trumps Rhetorik und seinem persönlichen Verhalten (z.B. nie eine Windel gewechselt zu haben) wird als bezeichnend hervorgehoben.
- Mögliche Auswirkungen: Stefan spekuliert, dass die aktuelle politische Lage und der wirtschaftliche Druck sich negativ auf die Geburtenrate auswirken könnten.
Jo Ann Beard: Cheri
Wolfgang stellt den Erzählungsband „Cheri“ der US-amerikanischen Schriftstellerin Jo Ann Beard vor und lobt ihre präzise und ungewöhnliche Schreibweise.
- Die Titelerzählung „Cheri“: Die Geschichte handelt von einer todkranken Frau, deren Leben in zufälligen Momentaufnahmen vor ihrem inneren Auge vorbeizieht. Wolfgang hebt die konkreten und eindringlichen Beschreibungen hervor, die eine besondere Atmosphäre schaffen.
- Weitere Erzählungen und Themen: Andere Geschichten behandeln existenzielle Fragen, Mensch-Tier-Verhältnisse und alltägliche Dramen, wie die Rettung einer Katze aus einem brennenden Haus.
- Der Essay „Zu“: Besonders beeindruckt zeigt sich Wolfgang von der Erzählung „Zu“, in der die Ich-Erzählerin, eine Schriftstellerin, versucht, ihre acht Enten vor Gefahren zu schützen und dabei über das Schreiben reflektiert. Die Autorin entwickelt eine Philosophie des Schreibens, die darauf abzielt, dem Leser in jedem Satz etwas Neues und Überraschendes zu bieten, ohne dessen Zeit zu stehlen. Die alltägliche Handlung des Enteneinfangens wird zur Metapher für den Schreibprozess.
- Allgemeine Würdigung: Wolfgang empfiehlt die Autorin nachdrücklich und lobt die Grundheiterkeit, die trotz der ernsten Themen in den Erzählungen mitschwingt.
Andreas Püttmann: Zwischen Christdemokratie und Rechtspopulismus
Stefan bespricht einen Text von Andreas Püttmann über die ideelle Orientierungslosigkeit der CDU/CSU unter Friedrich Merz.
- Christlich vs. Konservativ: Püttmann analysiert, dass der Begriff „konservativ“ erst spät (1978 im Ludwigshafener Programm) in die Programmatik der Union kam, die ursprünglich christlich und sozial ausgerichtet war. Umfragen zeigen, dass christliche Positionen in der Bevölkerung weiterhin positiver bewertet werden als rein konservative.
- Wahlergebnisse und die AfD: Trotz historisch schlechter Werte der Ampel-Regierung erzielte die Merz-Union ein schlechtes Wahlergebnis. Die CDU nähert sich rhetorisch und inhaltlich der AfD an, die mittlerweile als „etwas ungezogene Verwandte“ bezeichnet wird und ihr Wählerreservoir bei enttäuschten CDU-Anhängern findet. Püttmann warnt, dass sich die CDU/CSU, ähnlich wie DNVP und DVP in der Weimarer Republik, durch den Aufstieg der Rechtspopulisten halbieren könnte, anstatt die AfD zu halbieren, wie von Merz versprochen.
- Verlust des Fundaments: Die Union habe ihr christliches Fundament verloren, ohne dass dies vielen Mitgliedern bewusst sei, was zu einem substanziellen, strukturellen Problem führe. Die Rhetorik und die politischen Resultate von Merz stehen im Widerspruch zu seinen möglichen privaten Intentionen einer Abgrenzung zur AfD.
Sebastian Friedrich: Droht die Establishmentisierung der Linken?
Wolfgang und Stefan diskutieren einen Artikel von Sebastian Friedrich in Jacobin, der die Zustimmung der Linkspartei zur schnellen zweiten Kanzlerwahl von Friedrich Merz kritisch hinterfragt.
- Die Rolle der Linken bei der Kanzlerwahl: Die Linke ermöglichte durch ihre Zustimmung zur Änderung der Geschäftsordnung eine sofortige zweite Wahl von Merz, obwohl die Geschäftsordnung eine Pause von drei Tagen vorsah. Die Argumentation der Linken (Parteitag in Chemnitz) wird als nachrangig bewertet.
- Kritik an der Annäherung an das Establishment: Friedrich sieht eine allgemeine Tendenz der Linken, sich der politischen Mitte und dem Establishment anzunähern, etwa durch die unkritische Einreihung in die „demokratischen Parteien“ oder den positiven Bezug auf den Verfassungsschutz. Dies geschehe oft unter dem Deckmantel des Antifaschismus und einer Volksfront-Logik, die jedoch zur Selbstbindung an die herrschende Ordnung führen könne.
- Kontroverse Bewertung: Stefan bewertet das Vorgehen der Linken bei der Kanzlerwahl positiv und sieht darin einen legitimen parlamentarischen Akt, um Chaos zu verhindern und die CDU unter Druck zu setzen, die Linke als parlamentarische Kraft anzuerkennen. Er betont die Notwendigkeit, dass die Linke regierungsbeteiligbar sein müsse, ohne dass die Zugangsregeln zur Regierung verändert werden. Die außerparlamentarische Kritik solle sich darauf konzentrieren, den Wind in der Bevölkerung zu ändern, anstatt innerparlamentarische Prozesse zu kommentieren. Wolfgang bleibt skeptisch und sieht die Gefahr einer Establishmentisierung und eines Verlusts linker Positionen.
Norbert Walter-Borjans: „Zum fünften Mal mussten wir auf Verteilungsgerechtigkeit verzichten“
Stefan fasst ein Interview mit Norbert Walter-Borjans im Freitag zusammen, in dem dieser die Kompromisse der SPD im Koalitionsvertrag kritisiert, insbesondere den erneuten Verzicht auf eine Vermögenssteuer ohne adäquate Gegenleistungen.
- Diskrepanz zwischen Wahlprogramm und Koalitionsvertrag: Eine Analyse (mithilfe von KI) zeigt, dass zentrale Forderungen des SPD-Wahlprogramms (Entlastung für 95% der Steuerzahler, Revitalisierung der Vermögenssteuer, Reform der Erbschaftssteuer, höhere Besteuerung von Kapitalerträgen) im Koalitionsvertrag nicht oder nur abgeschwächt enthalten sind. Stattdessen sind sogar Senkungen der Körperschaftssteuer geplant.
- Kritik an den Ergebnissen: Walter-Borjans kritisiert die geringen Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen und die fehlende Gegenfinanzierung. Auch beim Thema Cum-Ex-Geschäfte sei der Koalitionsvertrag vage geblieben. Trotz der Kritik stimmte Walter-Borjans dem Koalitionsvertrag zu, was die Schwierigkeit verdeutlicht, aus etablierten politischen Mustern auszubrechen.
Katharina Pistor: Für Trump und Musk sind Universitäten Parasiten
Wolfgang bespricht ein Interview des Handelsblatts mit der Rechtswissenschaftlerin Katharina Pistor über die Situation an US-Universitäten unter der Trump-Regierung.
- Bedrohung der Demokratie und Wissenschaftsfreiheit: Pistor äußert die Sorge, dass die USA kein demokratisches Land mehr seien, und beschreibt Angriffe auf Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit der Wissenschaft.
- Angriff auf ausländische Studierende und die Folgen: Die mögliche Einschränkung von Visa für ausländische Studierende würde die Universitäten massiv schwächen, da diese einen erheblichen Teil der Studierenden und des Budgets ausmachen und wichtige Grundlagenforschung leisten, von der auch die Privatwirtschaft profitiere. Eine Kompensation durch rein amerikanische Studierende würde zu Qualitätsverlusten führen.
- Chance für Europa?: Pistor sieht eine Chance für Europa, Wissenschaftler anzuziehen, wenn entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen würden, kritisiert aber die aktuelle Sparpolitik in England und die Priorisierung von Rüstungsausgaben in Deutschland.
- Fehlender Widerstand in der Bevölkerung: Pistor erklärt den mangelnden Unmut in der breiten Bevölkerung damit, dass viele Amerikaner bereits in autoritären Systemen (ihren Arbeitsplätzen) leben und es daher nicht als neu empfinden, wenn auch der Rest des Lebens autoritär geprägt wird, oder sich sogar darüber freuen, dass es nun auch die „Eliten“ an den Universitäten treffe.
Alice Sara Ott spielt Nachtmusik von John Field
Wolfgang stellt eine CD der Pianistin Alice Sara Ott vor, auf der sie Nocturnes des heute fast vergessenen Komponisten John Field spielt, der als Erfinder dieser Gattung gilt.
- John Field und die Nocturnes: Field wirkte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und prägte Komponisten wie Chopin, Schumann und Liszt. Nocturnes sind einsätzige Charakterstücke für Klavier, die eine nächtliche, melancholische und träumerische Stimmung evozieren.
- Alisa Sara Otts Interpretation: Wolfgang lobt Otts Spiel als feinfühlig, dynamisch und nie pathetisch. Sie interpretiere die Stücke romantisch, ohne sie zusätzlich zu romantisieren. Ein Nocturne in A-Dur hebt er als besonders gelungen hervor, mit seinen Läufen, tänzerischen Momenten und der warmen Melancholie.
- Empfehlung: Die Musik sei ideal für ruhige Momente und biete eine willkommene Abwechslung von Hektik.




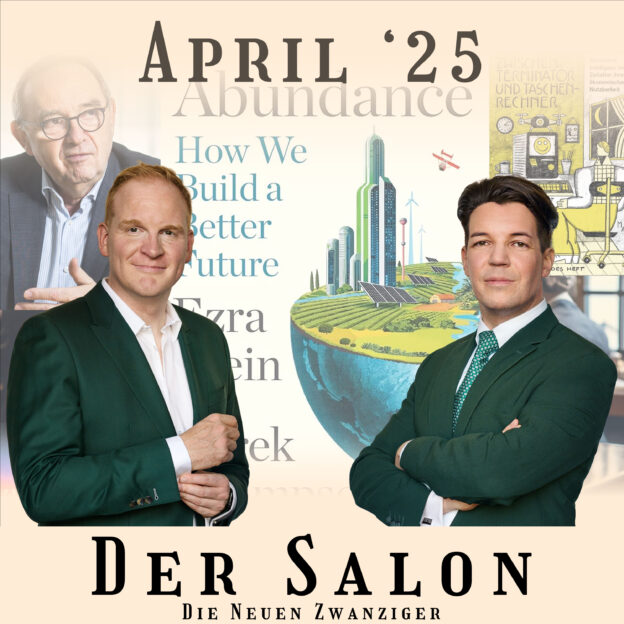
Wenn ich den Trump sehe, wie er in Saudi-Arabien über den überlangen fliederfarbenen Teppich geht und danach in den goldberstenen Sälen des saudischen Herrschers herumsitzt, muss ich unweigerlich an den „Charlie Chaplin“-Film „Der große Diktator“ denken.
– Diktatoren unter sich… (https://youtu.be/WDzGK7BDt90)
– Der Führer empfängt Benzino Napoloni (https://youtu.be/G1jubKBqcmk)
Das bizarre Getue, diese seltsamen Kostüme und das Krakelen der deutschen Nazi-Bande muss aus damaliger amerikanischer Sicht (<1940) fast ulkig gewirkt haben. Wann kommt der europäische Film über den Maga-Kult und den orange angesprühten Narzisten? Weiß Wolfgang mehr?
Ich frage mich auch, hatte der Volksempfänger damals die gleiche hypnotische, nervenzehrende Wirkung, wie wir es bei heutigem „Social Media“ beobachten? Kann man sich jetzt leichter in die Gedankengänge der Leute damals versetzen (abgesehen von einseitigem ökonimischen Missbrauch, wie immer)?
Ich höre euch wirklich gerne zu aber bitte macht endlich eure Hausaufgaben zu der Corona-„Pandemie“.
Bitte bringt euch auf den neusten Stand oder schweigt bitte dazu, es ist wirklich peinlich.
RKI papers sagtet ihr da muss man nichts mehr zu sagen aber solltet ihr vielleicht doch mal anschauen. Genaus wie die Studien zur wirksamkeit der MRNA Impfstoffe zustande gekommen sind. Jedenfalls sind letztere weder wirksam was Corona angeht, im besten Fall hat jedes Individuum keine (Neben-)Wirkung.
Bei der Pandemie sind weltweit nicht mehr Menschen gestorben als in einer starken Grippewelle und dort werden die Toten korrekt gezählt nicht, wie zur Coronazeit. MRNA kann durchaus eine Krebstherapie für jeden einzelnen werden, aber vermischt das bitte nicht mit einem Weltweit angewendeten Mittel, was wie es bisher aussieht mehr Leid verursacht hat als es verhindern sollte. Die Pandemie wurde nicht durch die Impfstoffe beendet. Bitte schaut euch die Statistiken an, Es ging noch schlimmer weiter. Es ging zu ende, weil man aufghört hat zu testen. Und das war auch der Ursprung der Pandemie und die Umdeutung was eine Pandemie eigentlich ist laut WHO.
Ich mag eure durchdringende Einschätzung zum aktuellen Zeitgeist wirklich gerne, aber dieses Thema solltet ihr wirklich aufarbeiten oder dann meiden wenn ihr Angst habt eure empfindlichen Hörer zu vergraueln.
Achso noch eine Sache über die AfD. Nicht dass ich diese jemals wählen würde aber eure Einstellung ist nicht ganz nachvollziehbar. Ihr seid so verwundert über die Kriegsbemühung unserer Regierung und all die Dinge die mit der Meinungsfreiheit passieren. Wie Gerichte immer mehr entscheiden was der Regierung passt und nicht was das Gesetz sagt. Der Verfassungsschutz ist genau wie das RKI der Regierung unterstellt und daher sind beide nicht als Autorität geeignet irgendwas festzustellen. Und warum war klar das die AfD rechtsextrem ist? könnt ihr das mal begründen? Und bitte bringt nicht solche Zitate von AfD politikiern, die vor zehn/zwanzig Jahren noch schlimmer von der CDU (Merkel etc. ) kamen.
Ihr habt berechtigt sorgen über die Richtung die die aktuelle Regierung einschlägt, habt aber mehr Angst vor einer Partei die noch nie an der Macht war. Die AfD hat kein interesse daran Krieg mit Russland zu führen. Wie kommt ihr darauf? Alle Menschen die ich kenne, die die AfD wählen sind gegen Krieg. Sicher ist die AfD eine verkappte FDP und daher machen sie auch gerne bei der NATO mit oder wollen wenigstens aufrüsten aber so Kriegsgeil wie unsere Regierung sind sie mit Sicherheit nicht und das schätzt ihr meiner Meinung nach vollkommen falsch ein.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist dass der Faschismus schon lange am aufkeimen ist und zwar mit all den Entwicklungen der letzten fünf Jahre. Die AfD zu verbieten wäre nur ein weiterer Schritt in diese Richtung. Mit Demokratie hat das alles schon lange nichts mehr zu tun. Ihr müsstet diese Entwicklung eigentlich sehen.
DIe Nazikeule und Kontaktschuld ist wieder da und ihr macht mit ohne eine Sekunde zu hinterfragen wem es nützt und ob das wirklich noch zieht/zeitgemäß ist außer bei Gerichten die dann das Verbot evtl. irgendwann aussprechen.
Diese beiden Artikel zum Abiturjahrgang 2025 passen wunderbar zusammen:
— Wenn Mama und Papa ein Plakat an der Schule aufhängen (Abiturprüfung)
https://www.spiegel.de/a-3736b439-9052-4e4e-94bd-60a102c5baaa
— Gießener Gymnasium wählt Naziparole als Abimotto — »NSDABI – Verbrennt den Duden«
https://www.spiegel.de/a-701d2613-4279-4002-857d-5ae64a7a884c
Wohlstandsverwahrlosung auf einem neuen Level. Aber bestimmt kann man für Klicks auf TikTok lustig dazu tanzen. Mit 14 jahren sind wir mit unserer Schulklasse zu einer Konzentrationslagergedenkstätte gefahren. Das war verpflichtend im Rahmen der Jugendweihe. Vorher machten auch bei uns bestimmte Schulhofwitzchen die Runde – Judenwitze (nicht mit jüdischen Witzen verwechseln) aber auch Hitlerwitze. Danach nie wieder. Wenn man einmal in seinem Leben vor einem aufgeschütteten Haufen menschlicher Zähne gestanden hat, hat man was gelernt. Man ist dann in seiner geistigen Reife geimpft.
Die Plakat-Muttis und -Pappis können sich heutzutage nicht mehr vorstellen ihren Prinzessinen oder Prinzlingen eine solche Erfahrung mitzugeben, es könnte ja »traumatisierend«!11!!EInsElf!!1! sein. Wo kommen diese Eltern her?
RE: Abundance, Polling
https://www.youtube.com/watch?v=YFLyFui8SHQ
https://www.axios.com/2025/05/28/democratic-voters-polling-populism-abundance
tl;dr The bottom line: „What these voters want is clear: a populist agenda that takes on corporate power and corruption,“ said Emily Peterson-Cassin, corporate power director at Demand Progress.